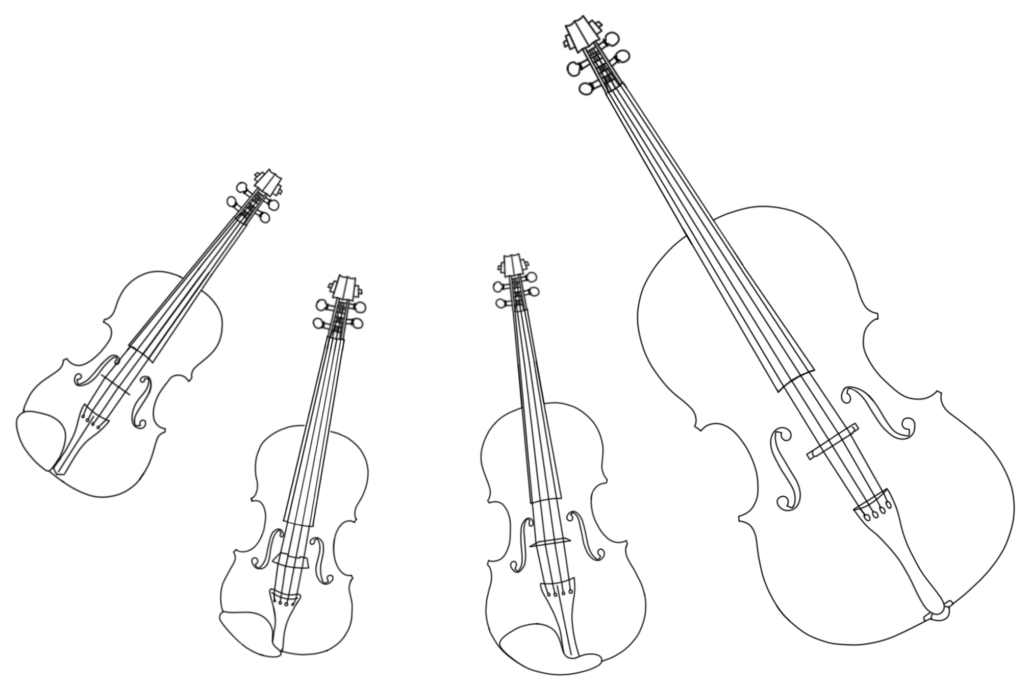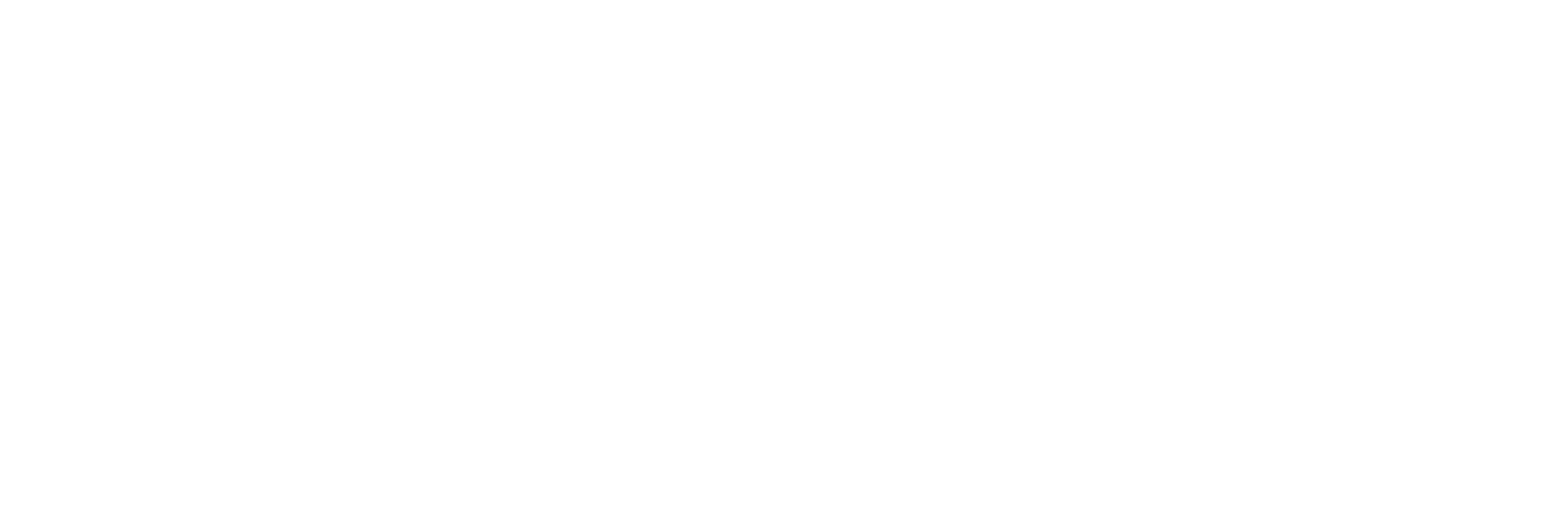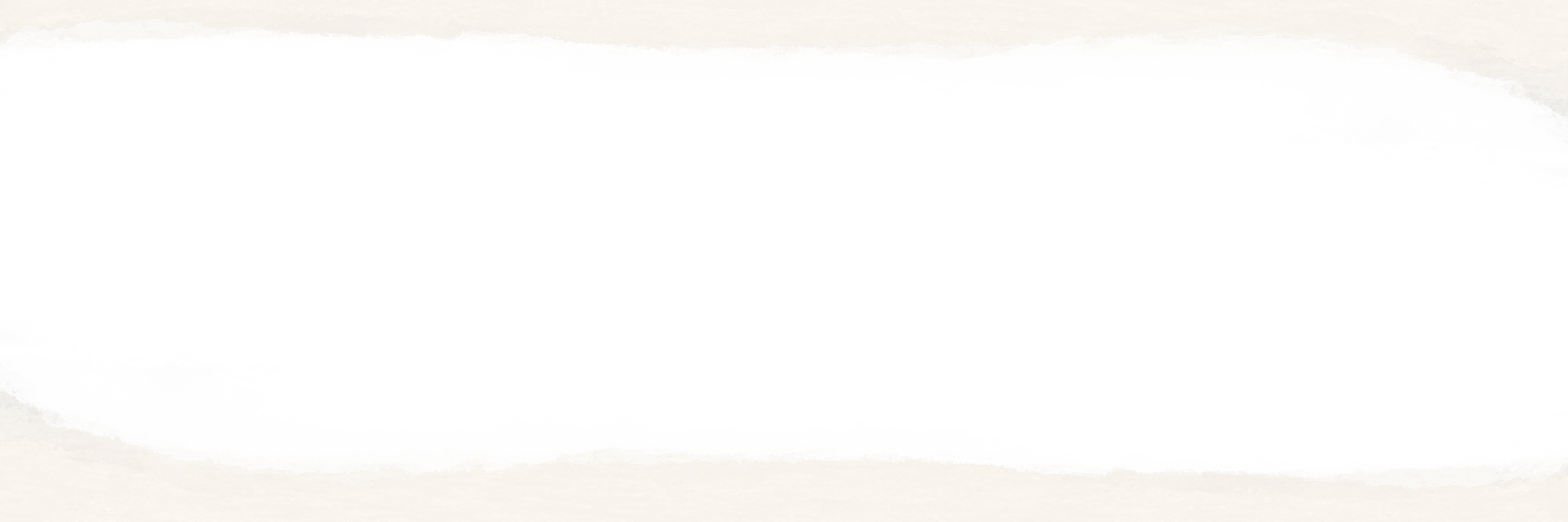Antonia Engelke: Liebe Frau Hennemann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview über das Hospiz an der Lutter. Sie arbeiten schon viele Jahre in dieser Göttinger Institution und sind stellvertretende Leiterin des stationären Bereiches.
Sylvia Hennemann: Guten Tag Antonia, ich bin erstaunt über Dein außergewöhnliches Interesse und freue mich sehr auf Deine Fragen.
Antonia Engelke: Wie viele Gäste betreuen Sie hier im Hospiz und wie lange bleiben sie durchschnittlich?
Sylvia Hennemann: Wir betreuen 10 Gäste, in der Regel über Wochen, manche auch über Monate
Antonia Engelke: Sind überhaupt jemals Plätze frei bei Ihnen oder müssen Sie auf Grund der hohen Nachfrage eine Interessentenliste führen?
Sylvia Hennemann: Es sind keine freien Plätze vorhanden, sodass wir Wartelisten führen für Gäste, die dringend zu uns wollen und solche, bei denen noch mehr Zeit bleibt und alles besser geplant werden kann. Manchmal ist es schwierig, die Gäste, die in unser Hospiz passen, zu identifizieren, gegenüber denen, die besser zum Beispiel in der Palliativmedizin aufgehoben sind.
Antonia Engelke: Wie ist das durchschnittliche Alter der Gäste?
Sylvia Hennemann: Das ist unterschiedlich. Durchschnittlich, würde ich sagen, um die 60 -70 Jahre. Wir haben auch manchmal sehr viele jüngere Gäste und auch hochbetagte. Aber der Schnitt liegt bei etwa 60 Jahren.
Antonia Engelke: Wer kommt zu Ihnen? Welche Grunderkrankungen sind häufig?
Sylvia Hennemann: Es kommen eigentlich alle Patienten als Gäste zu uns, häufig Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder auch Krebserkrankungen. Es gibt eigentlich keine absoluten Ausnahmen. Natürlich können wir technische medizinische Behandlungsverfahren wie Beatmung als Hospiz nicht anbieten.
Antonia Engelke: Wie viele Mitarbeiter sind hier tätig? Wie verteilt sich die Arbeit auf haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter?
Sylvia Hennemann: Wir haben insgesamt 27 Mitarbeiter unterschiedlicher Stundenanzahl, 27 Personen im Pflegepersonal. Wir arbeiten in drei Schichten. In der Frühschicht sind immer drei Mitarbeiter, in der Spätschicht drei und in der Nachtschicht zwei Mitarbeiter für zehn Gäste zuständig.
Antonia Engelke: Wer trägt die Kosten?
Sylvia Hennemann: Die Kosten werden von den Krankenkassen zu vereinbarten Tagessätzen getragen. Zusätzlich haben wir einen Kreis von regelmäßigen Spendern.
Antonia Engelke: Gibt es einen Unterschied zwischen den Gästen hier im Hospiz und den Patienten auf der Palliativstation der Universitätsmedizin? Gibt es medizinische Ausschlusskriterien für einen Aufenthalt im Hospiz?
Sylvia Hennemann: Ja, es gibt natürlich Patienten, die in der Palliativmedizin besser aufgehoben sind, besonders, wenn sie spezielle medizinische Therapien benötigen.
Antonia Engelke: Können Angehörige im Hospiz wohnen? Dürfen Gäste auch Haustiere mitbringen?
Sylvia Hennemann: Ja, explizit können Angehörige hier wohnen und tun das auch zum Teil über Monate, tun nichts anderes, als ihren Angehörigen zu begleiten. Häufig ist es bei Frauen so, dass sie sich verpflichtet fühlen, auch das Eheversprechen auf diese Art zu erfüllen, Männer haben da nicht immer dieses ausgeprägte Pflichtbewusstsein.
Antonia Engelke: Welche Rolle spielt der Kontakt mit den Angehörigen für Sie? Was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig, was die Begleitung der Angehörigen betrifft?
Sylvia Hennemann: Die Angehörigen sind für uns genauso wichtig wie unsere Gäste. Sie müssen natürlich erst einmal von den Gästen akzeptiert sein. Viele wollen bei uns sein, werden jedoch von den Gästen nicht gewünscht. Wir sagen ja „Gäste“ und nicht „Patienten“. In so einer Situation müssen wir dann eingreifen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit den Angehörigen ganz eng zusammenarbeiten, denn wir sind ja eigentlich nur am Lebensende dabei und das Leben, das vorher stattgefunden hat, ist ja ganz wichtig. Sie sind ja vielleicht 60 oder 70 Jahre mit den Angehörigen zusammen, die dann viel besser wissen als wir, was gut und was nicht gut ist für ihre Angehörigen, also für unsere Gäste. Sie können also einen wertvollen Beitrag leisten, zum Beispiel was das Lieblingsessen betrifft, die Wassertemperatur bei der Körperpflege, und so weiter. Das wissen die Angehörigen meistens am besten, wenn die Gäste nicht mehr sprechen können. Das kommt auch häufig vor, dass die Gäste sich nicht mehr äußern können.
Antonia Engelke: Zwei Drittel der Deutschen möchten im Moment des Todes nicht allein sein. Setzen sich Angehörige deshalb oft unter Druck? Und ist es tatsächlich oft so, dass die Menschen genau dann sterben, wenn sie ganz allein sind?
Sylvia Hennemann: Ja, das ist besonders bei Ehefrauen so, die auch in dieser Situation ihr Eheversprechen einlösen wollen. Häufig ist es so, dass Gäste bei uns allein versterben in einem Moment, wenn die Angehörige gerade vielleicht einmal 20 Minuten nicht im Raum ist.
Antonia Engelke: Bleiben Kontakte zu den Angehörigen auch über den Tod des Gasts hinaus bestehen?
Sylvia Hennemann: Ja, es bleiben teilweise intensive persönliche Kontakte bestehen, die dazu führen, dass Angehörige auch diesen letzten Weg für sich wählen wollen oder ein längerer persönlicher Kontakt gepflegt wird. Außerdem gibt es die jährlichen Gedenk-Gottesdienste für Angehörige, die immer gut besucht sind, also eine wichtige Funktion erfüllen.
Antonia Engelke: Was ist, wenn jemand den Kontakt zu Angehörigen verloren hat? Raten Sie ihm, ihn evtl. wieder aufzunehmen und ist dann häufig eine Versöhnung möglich?
Sylvia Hennemann: Wir sind hier, hören zu und sprechen mit den Angehörigen. Allerdings kommentieren wir diese Situation nicht, denn es sind häufig lange zurückliegende Ereignisse, die zu Problemen geführt haben. Wir respektieren hier in erster Linie die Wünsche unserer Gäste.
Antonia Engelke: Wie wichtig ist das Mitbringen persönlicher Gegenstände, auch von Möbeln etc., wenn Gäste ins Hospiz kommen?
Sylvia Hennemann: Ja, das ist in der Tat sehr wichtig. Eigene Möbel können im Rahmen des Platzangebotes mitgebracht werden. Jeder soll sich hier so richtig wohl fühlen. Manche Gäste bringen auch ihren Hund oder Vogel mit. Katzen mögen nicht gern in Räumen bleiben, sind deshalb häufig etwas schwieriger hier unterzubringen.
Antonia Engelke: Helfen Sie dabei, letzte Wünsche zu erfüllen (z.B. noch einmal den Strand sehen, ein letztes Mal Spargel essen)? Arbeiten Sie mit entsprechenden Organisationen zusammen?
Sylvia Hennemann: Ja, für den Fall, dass besondere Mahlzeiten gewünscht werden, versuchen wir, das hausintern zu realisieren. Naja, Sushi würden wir beispielsweise kaufen. Aber um auf die Ausflüge zu sprechen zu kommen, gibt es da den Malteser-Hilfsdienst, der einen so genannten Wünschewagen bereithält. Dieser Wünschewagen kommt mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern (das muss vorher angemeldet werden und der Hausarzt muss zustimmen) und dann kann es sein, dass der Gast noch einmal nach Travemünde fährt. Das ist dann eine Tagesfahrt ohne Übernachtung, die von den Maltesern, die da sind, nicht geleistet werden kann. Man fährt dann eventuell morgens um 5:00 Uhr los und ist abends um 22:00 Uhr wieder zurück und hat dann dafür den Tag am Wasser verbracht.
Antonia Engelke: Wie häufig kommt es vor, dass Hospizgäste das Hospiz wieder verlassen, um noch einmal nach Hause zurückzukehren?
Sylvia Hennemann: Es kommt durchaus vor, allerdings ist dann unklar, ob sie wieder in das Hospiz zurückkehren, wenn es ihnen besser geht. Allerdings wird das als letzter Wunsch natürlich ggf. genauso respektiert wie eine Fahrt an das Meer.
Antonia Engelke: Welche Rituale haben Sie etabliert, wenn ein Gast gestorben ist?
Sylvia Hennemann: Ja, da haben wir einige Rituale: Wir haben ein Gedenkbuch, da wird der Gast sofort eingetragen, wenn er zu uns gekommen ist. Später wird eingetragen, wann er verstorben ist – und sein Geburtsdatum. In dem Buch werden keine Adresse oder sonstige persönliche Daten eingetragen. Und dann haben die Angehörigen die Möglichkeit, eine weitere Seite selber zu gestalten, in die sie etwas eintragen, ein Bild einkleben oder etwas ähnliches. Wir haben auch eine Gedenk-Kerze. Das ist die einzige Kerze, die in diesem Haus im Rahmen der Brandschutzvorschriften brennen darf. Die dürfen wir dann auf dem Flur anzünden. Im Zimmer selbst zünden wir dann eine elektrische Kerze an. Im Zimmer wird dann der Gast noch einmal besonders gepflegt und angezogen, seinen Wünschen beziehungsweise den Wünschen seiner Angehörigen entsprechend. Wenn er beispielsweise gesagt hat, es ist ihm egal, dann fragen wir die Angehörigen. Dann wird er aufgebahrt. Es wird gefragt, ob eine Aussegnung stattfinden soll. Das kann im Bedarfsfall jeder von uns machen. Aber wir würden im Regelfall unseren Seelsorger hinzuziehen.
Antonia Engelke: Wie lange bleibt der Verstorbene nach dem Eintritt des Todes bei Ihnen?
Sylvia Hennemann: Er bleibt, bis er vom Bestatter abgeholt wird. Er wird nicht, wie im Krankenhaus üblich, in die Pathologie gebracht, sondern er bleibt in seinem Zimmer, in dem er verstorben ist und aufgebahrt ist. Dort können noch die Menschen Abschied nehmen, die ihm lieb waren, und dann kommt irgendwann der Bestatter, meistens am nächsten Tag. Längstens kann er 48 Stunden bei uns bleiben. Es ist aber meistens ein Tag, der vergeht. Und unsere Mitarbeiter würden sich ja auch von ihm verabschieden wollen.
Antonia Engelke: Welche Rolle spielt die christliche Ausrichtung des Hospizes in der Praxis? Wie gehen Sie mit anders- oder nichtgläubigen Gästen um?
Sylvia Hennemann: Natürlich haben wir als christliches Hospiz unsere Grundsätze, nach denen unsere Gäste und deren Angehörige gleichermaßen mit Respekt behandelt und die gesamte Arbeit verrichtet wird. Die Religion bzw. Konfession wird respektiert. Angehörige anderer Religionen wie Menschen muslimischen Glaubens werden gemäß den Erfordernissen ggf. rasch in der UMG zur Bestattung vorbereitet, wo eine entsprechend spezialisierte Körperpflege durchgeführt werden kann.
Leben und Sterben im Hospiz
Antonia Engelke: Viele Menschen verbinden mit einem Hospiz Schmerzen, Angst, Trauer und eine durchweg getrübte Stimmung, die sich wie ein Schleier auf die Atmosphäre legt. Sind diese dunklen Gedanken begründet? Können Sie mit wenigen Worten das Leben und Sterben in einem Hospiz beschreiben?
Sylvia Hennemann: Bunt. Und sehr fantasievoll. Ja, das kann man eigentlich so sagen. Ich habe gerade heute Morgen einen Besuch gehabt, der dieselbe Frage gestellt hat. Ja, wir wissen eigentlich morgens alle nicht, wenn wir morgens ins Hospiz kommen, was uns erwartet.
Antonia Engelke: Ist die Entscheidung eines Menschen, in ein Hospiz zu gehen bzw. die Entscheidung der Angehörigen, die Pflege im häuslichen Umfeld zu beenden, auch mit Versagensängsten und Schuldgefühlen verbunden?
Sylvia Hennemann: Nein, also aus meiner Sicht nicht. Heutzutage sind auch viele Menschen darauf vorbereitet, wenn sie ins Hospiz kommen. Natürlich ist das immer ein Abschied von zu Hause, von lieben Menschen. Selbst wenn man aus dem Krankenhaus zu uns verlegt wird oder von der Palliativstation, möchte man ja erst einmal per se wieder nach Hause. Aber das ist dann nicht so. Hier ist dann ein Zuhause-Ersatz. Und das versuchen wir, so gut wie möglich hinzubekommen: dass es auch wirklich ein Ersatz ist für ein Zuhause. Wir erfragen die Wünsche von vornherein, wir beziehen von vorneherein die Angehörigen mit ein. Sie können auch, bevor der Gast zu uns kommt, das Zimmer bereits gestalten. Wir fragen immer: Möchten Sie kommen? Sie können das mitbringen, was ihr/e Angehörige(r) am liebsten zu Hause hatte. Sie können auch selber mit einziehen. Das ist auch ganz wichtig, denn viele möchten sich auch nicht noch einmal verabschieden, wenn man lange verheiratet war. So und so möchte man sich bis zum Schluss begleiten, und dann zieht derjenige hier ein. Im Moment haben wir viele, die ihre Angehörigen hier begleiten und ständig leben bei uns.
Antonia Engelke: Wie gibt man Ihrer Meinung nach schwerkranken Menschen am besten mehr Lebensqualität?
Sylvia Hennemann: Indem man ihre Wünsche erfüllt.
Antonia Engelke: Welche Rolle spielen Vorlieben der Gäste im Hospizalltag, z.B. die Zubereitung von Lieblingsspeisen etc.?
Sylvia Hennemann: Eine große Rolle. Es ist ganz wichtig, besondere Vorlieben zu kennen und zu respektieren, Wünsche zu erfüllen.
Antonia Engelke: Besprechen Sie mit den Gästen Details über die Bestattung bzw. besteht der Wunsch nach solchen Gesprächen eher häufiger oder eher selten?
Sylvia Hennemann: Häufiger, würde ich sagen. Manchmal ist auch alles schon geklärt, bevor jemand hierher kommt, aber wenn, wird offen darüber gesprochen, also jeder weiß, dass er hier im Hospiz versterben wird. Und mit dieser Gewissheit, das ist so eine Klarheit, die nicht beschönigt werden muss. Deshalb geht man auch offener damit um. Diese Offenheit habe ich immer sehr geschätzt.
Antonia Engelke: Welchen Stellenwert haben Gespräche über das Lebensende, den Sinn des Sterbens, über Ängste, aber auch vielleicht über die Zufriedenheit mit einem gelingenden Leben?
Sylvia Hennemann: Ganz großen Stellenwert. Wir bieten auch psychoonkologische Gespräche an. Wir haben zwei Mitarbeiter, die eine spezielle Ausbildung dafür haben, sodass man hier manchmal richtig ins Detail geht. Wir bieten auch eine würdezentrierte Gesprächstherapie an. Und eine unserer Mitarbeiterinnen verfasst dann ein Biografie-Buch. Das wird anschließend transkribiert und die Angehörigen bekommen das anschließend als gebundene Ausgabe ausgehändigt.
Antonia Engelke: Wie unterscheidet sich die Begleitung junger von der Begleitung alter Menschen im Hospiz?
Sylvia Hennemann: Das ist eine sehr gute Frage. Da stoßen wir auch sehr oft an unsere Grenzen. Im Moment haben wir eine ganz junge Mama mit zwei kleinen Kindern bei uns und auch eine weitere junge Frau, die allerdings keine Kinder hat, nicht verheiratet ist und sehr eng von ihrer Mama begleitet wird. Ja – junge Menschen, wie gehen wir damit um? Je jünger eigentlich die Gäste sind, desto offener gehen sie mit der Situation um, meiner Erfahrung nach. Und teilweise ist es dennoch schwer.
Antonia Engelke: Gibt es im Hospiz viele Menschen, die „lebenssatt“ versterben, sich verabschiedet und die Dinge mit ihren Angehörigen besprochen haben, die besprochen werden mussten?
Sylvia Hennemann: Ja, das gibt es auch. Die, die wir eigentlich „nur“ begleiten. Sie werden begleitet bis an ihr Lebensende, aber sie haben eigentlich alles schon geregelt, sage ich jetzt mal so. Ja, die haben alles schon geregelt, was geregelt werden muss
Antonia Engelke: Haben Sie in Ihrer langjährigen Berufstätigkeit bemerkt, dass die Gäste spüren, wann der Tod kommt?
Sylvia Hennemann: Ja. Ja, das spüren tatsächlich die Menschen – das habe ich nicht nur hier gemerkt, sondern auch anderswo. Genau, es gibt Anzeichen dafür: Manche nesteln mit ihren Händen herum, werden unruhiger, haben erhöhten Puls. Man kann das auch manchmal an den Vitalzeichen erkennen. (Nickt)
Antonia Engelke: Gibt es einen Weg, wie sich Angehörige am besten auf den Abschied vorbereiten können?
Sylvia Hennemann: Das ist auch eine gute Frage (denkt nach). Ich glaube, den idealen Weg, den weiß keiner. Den muss auch jeder für sich selber herausfinden: was jeder braucht, um Abschied zu nehmen. Und das kann bei jedem anders sein.
Antonia Engelke: Sie haben bereits viele Menschen bei ihrer letzten Reise begleitet. Gibt es ihrer Meinung nach auch ein schönes Sterben?
Sylvia Hennemann: Ja, ein schönes Sterben ist dann, wenn ich nicht allein bin – das ist hier in der Regel der Fall. Hier ist niemand allein. Es gibt drei Wünsche, die Gäste von uns immer wieder äußern: Ich will keine Schmerzen, ich will keine Luftnot und ich möchte nicht alleine versterben. Und das ist in der Regel hier gegeben, dass diese drei wichtigen Punkte erfüllt werden.
Persönlicher Umgang mit dem Tod im Kontext der Berufstätigkeit
Antonia Engelke: Was schätzen Sie an Ihrem Beruf? Was empfinden Sie als Bereicherung?
Sylvia Hennemann: Also, ich bin Krankenschwester geworden, habe zwischen 1978-81 meine Ausbildung absolviert und habe den Beruf von Anfang an gern ausgeübt. Ich habe in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, in der ambulanten Pflege, im Krankenhaus, jetzt hier im Hospiz, im SAPV, der speziellen ambulanten Palliativversorgung, und ich habe alles sehr gern gemacht.
Antonia Engelke: Stellt die Arbeit im Hospiz für Sie persönlich auch eine Belastung dar?
Sylvia Hennemann: Für mich persönlich eine Belastung- (überlegt) – ja, die jungen Patienten; die jungen Gäste, die bei uns sind und sterben. Das geht manchmal so nah.
Antonia Engelke: Wie schaffen Sie es, Ihre Gäste nicht sinnbildlich „mit nach Hause“ zu nehmen?
Sylvia Hennemann: Ja, die nehme ich manchmal mit nach Hause: die jungen (lacht), die jungen Menschen. Ja, ich mache natürlich auch Yoga und habe auch einen großen Freundeskreis und kann mit den Menschen sprechen. Wir haben Supervisionen, was auch sehr wichtig ist: Wir können unsere Dinge, die uns belasten, auch mit der Supervisorin besprechen. Und wir haben ein tolles Team. Die Supervision ist alle 4-6 Wochen, aber das Team ist immer da. Und wir sind unterschiedlich. Jeder bringt seine Individualität ein.
Antonia Engelke: Wie werden ehrenamtliche Mitarbeiter auf ihre Tätigkeit im Hospiz vorbereitet? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?
Sylvia Hennemann: Sie werden vorbereitet, indem sie einen Kursus bei uns belegen. Unser ambulantes Hospiz bildet selbst aus. Ich glaube, es sind zwölf Abende à 2 Stunden, also 24 Stunden. Die Voraussetzung ist der Wunsch, für Menschen da zu sein und Wünsche zu erfüllen.
Antonia Engelke: Bemerken Sie bei sich selbst bzw. bei Ihren Mitarbeitern eine Veränderung, die durch Ihre Tätigkeit im Hospiz bedingt sein könnte?
Sylvia Hennemann: Oh ja. Ich habe bemerkt, dass ich sehr demütig werde. Wenn ich einmal im Urlaub längere Zeit nicht da war, habe ich mich manchmal über Kleinigkeiten aufgeregt zu Hause. Sobald ich hier zurück war, erkannte ich sofort wieder die wirklich wichtigen Dinge. Es gibt viel schlimmere Dinge, und da wird man ganz demütig. Man wird doch dankbar für das, was man hat.
Antonia Engelke: Wenn Sie persönlich in eine Situation gerieten, in der sie bald Abschied von einem geliebten Menschen nehmen müssten, würden sie sich für Ihre Angehörigen das Sterben im Hospiz, im Krankenhaus oder im eigenen Heim wünschen?
Sylvia Hennemann: Im eigenen Heim (lächelt).
Antonia Engelke: Können Sie eine Begegnung mit einem Sterbenden schildern, die Sie ganz besonders berührt hat?
Sylvia Hennemann: Ja, und zwar wenn Menschen versterben, die ich intensiv betreut habe und die dann in meinem Beisein versterben: Das empfinde ich immer als Dankbarkeit. Ich sage mir immer: Der hat sich mich ausgesucht. Hat so viel Vertrauen gehabt, dass er bei mir loslassen kann von seinem Leben. Und das ist es eigentlich. Da empfinde ich Dankbarkeit.
Hospizarbeit und Palliativmedizin in der Öffentlichkeit – aktuelle Situation und Ausblick
Antonia Engelke: Laut Insa-Meinungsumfrage hat jeder zweite Deutsche Angst vor dem Sterben. Warum ist das so, und verschiebt sich bei Ihren Gästen diese Angst auf die Angehörigen, die ja weiterleben und alleine bleiben?
Sylvia Hennemann: Das ist eine sehr gute Frage. Wir beobachten, dass Angst vor dem Unbekannten das häufigste Motiv ist und wir mit unserer Fürsorge und der richtigen Therapie die Patienten hier von der Angst befreien können. Häufig entscheiden sich dann die Angehörigen aufgrund dieser Erfahrungen, dazu später einmal zu uns zurückzukommen.
Antonia Engelke: Trägt die Öffentlichkeitsarbeit des Hospizes dazu bei, den Tod ein Stück weit zu enttabuisieren?
Sylvia Hennemann: Ja, wir glauben schon. Einen sehr großen Einfluss hat diesbezüglich sicherlich unser regelmäßiger Hospizinfostand in Göttingens Fußgängerzone.
Antonia Engelke: Wie stehen Sie persönlich zur Frage des assistierten Suizids? Werden Sie manchmal darum gebeten, und wie gehen Sie mit dieser Bitte um?
Sylvia Hennemann: Oh, das ist ein wirklich schwieriges Thema: assistierter Suizid. Wir hatten auch schon eine große Veranstaltung, die die unterschiedlichen Meinungen hierzu thematisierte. Meine ganz persönliche Meinung hierzu ist: Hier im Hospiz halte ich es für nicht umsetzbar, weil das unserer Arbeit widerspricht, also gleichermaßen einem Verrat an unseren Idealen gleichkommt. Wir versuchen eigentlich, den natürlichen Weg mit dem Gast zu Ende zu gehen. Also: Jeder soll so viel Zeit erleben, wie ihm geschenkt worden ist, und wenn ich meinem Leben jetzt vorzeitig ein Ende setze, dann wäre das für mich persönlich sicher eine Art Versagen, wenn wir nicht in der Lage wären, den Betroffenen alle Wünsche zu erfüllen und die Symptome, die er hat, zu lindern. Das ist natürlich schlimm. Es kommen natürlich Menschen, die den Wunsch äußern, schnell und möglichst sofort zu versterben und ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch wenn sie erstmal eine Zeit bei uns gelebt haben – die Schmerzen sind nicht mehr da, ich habe keine Luftnot, und vor allem bin ich nicht allein – dann ist der Wunsch zu versterben oft nicht mehr da. Ich halte es bei uns nicht für umsetzbar.
Antonia Engelke: Denken Sie, dass in Deutschland die Möglichkeiten der Palliativmedizin überhaupt flächendeckend ausgeschöpft werden? Wäre das der Fall – glauben Sie, dass sich die Frage nach dem assistierten Suizid überhaupt noch stellen würde?
Sylvia Hennemann: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir beobachten so oft, dass Patienten nach Linderung ihrer Symptome und in Betreuung wieder zugänglicher und zufriedener werden und diese Frage vom Tisch ist. Also hängt das für mich mit einer adäquaten Therapie und Fürsorge zusammen.
Antonia Engelke: Ist die Symptomkontrolle von z.B. Schmerzen und Übelkeit vollständig möglich?
Sylvia Hennemann: Häufig ja, allermeistens weitgehend.
Antonia Engelke: Wie wägen Sie zwischen Therapie zur Schmerzfreiheit und Sedierung ab?
Sylvia Hennemann: Zunächst gilt es, den Gast möglichst weitgehend schmerzfrei zu bekommen. Es gibt ein Stufenschema der Sedierung, das in der richtigen Anwendung einen Segen für die Gäste darstellen kann.
Antonia Engelke: Gibt es einen Unterschied zwischen der Angst vor dem Sterben und der Angst vor dem Tod?
Sylvia Hennemann: Ja, ja, genau, der Weg zum Tod ist ja der Sterbeprozess. Davor haben einige Menschen Angst.
Antonia Engelke: Stimmt der Satz „Wir sterben, wie wir gelebt haben“?
Sylvia Hennemann: Hm, nicht immer – aber da fällt mir gerade ein Gast ein, den wir hatten. Es war ein Junggeselle, der schon ganz schmal und abgemagert zu uns gekommen war. Er war Raucher und um die 65. Manchmal hat er gern ein Bier getrunken. Wir haben ihm das auch alles erlaubt. Dann ist er von Bier auf Cola umgestiegen und hat nichts mehr gegessen und hat noch drei Monate bei uns gelebt, und er hat noch sehr gerne bei uns gelebt, ohne Verwandte, ohne Bekannte – und ist hier sozusagen gestrandet.
Antonia Engelke: In Göttingen wird ein Kinderhospiz gebaut. Wird es eine Zusammenarbeit geben?
Sylvia Hennemann: Wir hatten schon Kontakt mit dem Kinderhospiz. Allerdings ist noch kein Spatenstich erfolgt, so dass es derzeit noch nicht sinnvoll ist, ständig in Kontakt zu sein. Für uns ergibt sich ein potentieller Ansatzpunkt für Gäste mit Kindern, die dann das Trauerangebot des Kinderhospizes wahrnehmen könnten, so dass ihnen dort besser geholfen werden kann.
Antonia Engelke: Was wünschen Sie sich persönlich für das Hospiz an der Lutter und für die Hospizarbeit im Allgemeinen?
Sylvia Hennemann: Ganz viele Menschen, die offen mit dem Thema Tod und Sterben umgehen können.
Antonia Engelke: Frau Henneberg, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und die wertvollen Einblicke in das Hospiz an der Lutter.